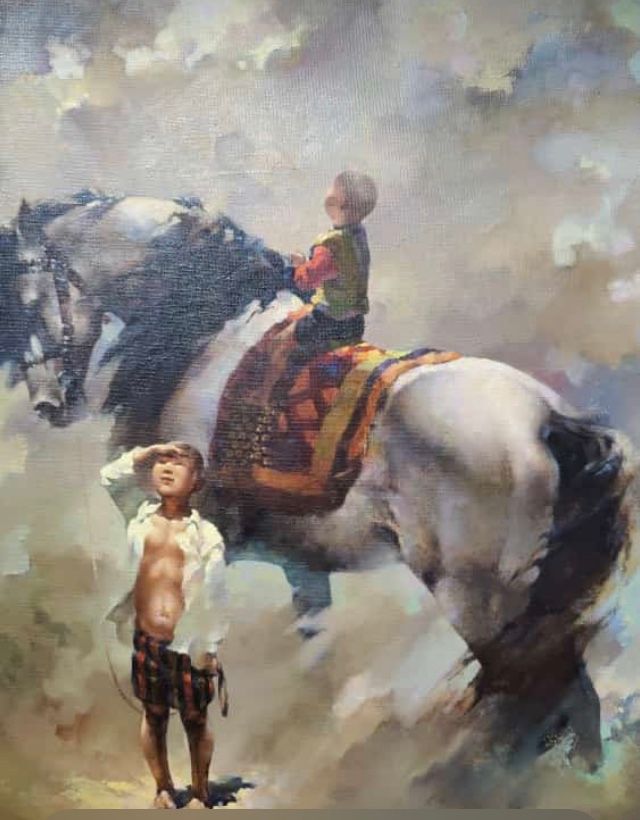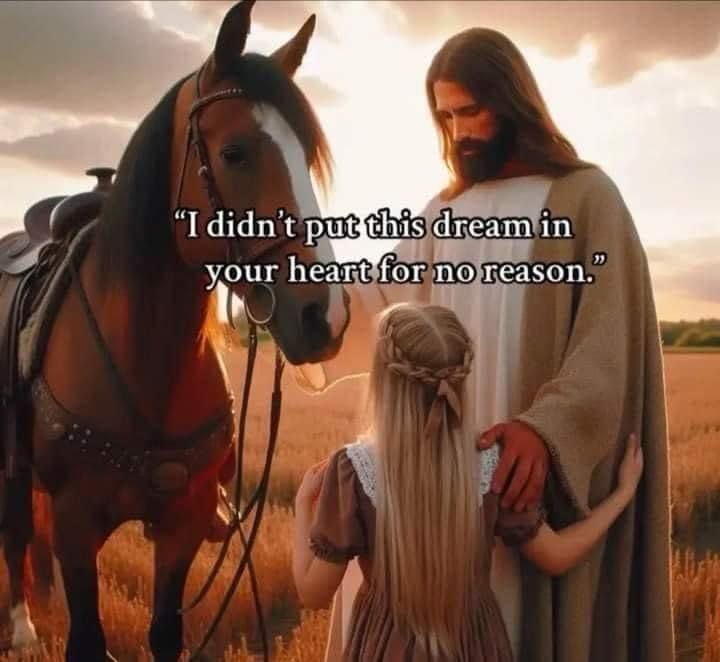Ein Individuum (lat. individuum ‚Unteilbares‘, ‚Einzelding‘) ist ein Ding, eine Entität oder einzelnes Seiendes, insofern es von Gegenständen klar unterschieden werden kann, d. h. wenn Identitätskriterien angegeben werden können.
Der Ausdruck „Individuum“ wird insbesondere auf Menschen angewendet, um sie als moralische Subjekte, d. h. als Träger von Rechten, Verantwortungen und Pflichten zu kennzeichnen.
In diesem Sinn wird statt von „Individuen“ auch von „Personen“ geredet.
Bei Personen werden zudem individuelle Eigenschaften, Interessen und Besonderheiten von denen der Bevölkerungsgruppe (Gemeinschaft, Gesellschaft, Kollektiv) der sie entstammen, abgegrenzt und als subjektive Elemente der Persönlichkeit der Individualität zugerechnet.
Ideengeschichte
Einer der ersten, die im Kulturkreis des europäischen Abendlands das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft thematisiert haben, war Aristoteles, der in seiner Politik den Menschen als zoon politikon, also als Gemeinschaftslebewesen bezeichnete.
Demgegenüber steht die Privatperson, bezeichnet als idiotes.
In neuerer Zeit war es Jean-Jacques Rousseau, der das Thema durch seine Unterscheidung von Willen aller (aller Individuen) einerseits und allgemeinem Willen (Willen der Gemeinschaft) andererseits neu behandelte.
Die klare Formulierung einer Kluft zwischen den Interessen der Einzelnen und den systematischen Interessen einer Organisation, die wiederum bestimmte Interessen der Einzelnen bedient, ist aber seitdem vor allem ein Thema der Ökonomie geworden.
Insbesondere die Spieltheorie untersucht die daraus resultierenden Konflikte und Interessenbalancen, siehe z. B. das Trittbrettfahrerproblem.
In der liberalen Wirtschaftstheorie im Anschluss an Adam Smith wird hingegen
– ganz im Gegensatz zur Aussage von Rousseau und Adam Smith selbst – davon ausgegangen, dass die Summe der Einzelegoismen automatisch „zum größtmöglichen Glück der größten Zahl“ führen kann (Jeremy Bentham).
Der Staat solle seine Aktivitäten auf wenige Ausnahmen
– die Gewährleistung der äußeren und inneren Sicherheit –
beschränken, was polemisch häufig als Idee vom Nachtwächterstaat bezeichnet wurde.
Die Bedeutung des Individuums schwankt in der Geistesgeschichte kulturrelativ sehr stark.
Die Moderne, die heute die Westliche Welt bestimmt, betont das Individuum im historischen wie auch im interkulturellen Vergleich sehr stark.
Diese starke Betonung des Individuums wird auch Individualismus genannt und steht im Gegensatz zum Kollektivismus.
Die geistesgeschichtliche Streitfrage ist die nach der Bedeutung und Autonomie des Einzelnen im Vergleich zu der Gemeinschaft, in der er lebt.
In neuerer Zeit wurde dies in den Extrempositionen von Max Stirner
(Der Einzige und sein Eigentum) und dem Nationalsozialismus
(„Du bist nichts, Dein Volk ist alles“) besonders deutlich.
Dem Individualismus kommen Gedankensysteme wie der Anarchismus oder der Liberalismus sehr entgegen.
Die Gegenpositionen zum Individualismus nehmen besonders sozialistische Systeme ein.
Es gibt allerdings Ausnahmen von dieser groben Orientierung.
So betont etwa der Liberale Max Weber das Volk als hohen Wert, während es Sozialisten gibt, die eine Gesellschaftsordnung anstreben, in der der Einzelne ohne gesellschaftliche Bindung leben kann.
Die Abhängigkeit der Moral und Ethik von der Gesellschaft hat der Soziologe Émile Durkheim herausgearbeitet.
Ihm zufolge gibt es Moral überhaupt erst durch das Kollektiv.
Das Individuum an sich kennt keine Moral.
Nach Durkheim sind so auch Verbrechen nichts als ein Verstoß gegen „kollektive Gefühle“.
Quelle: anthrowiki.at