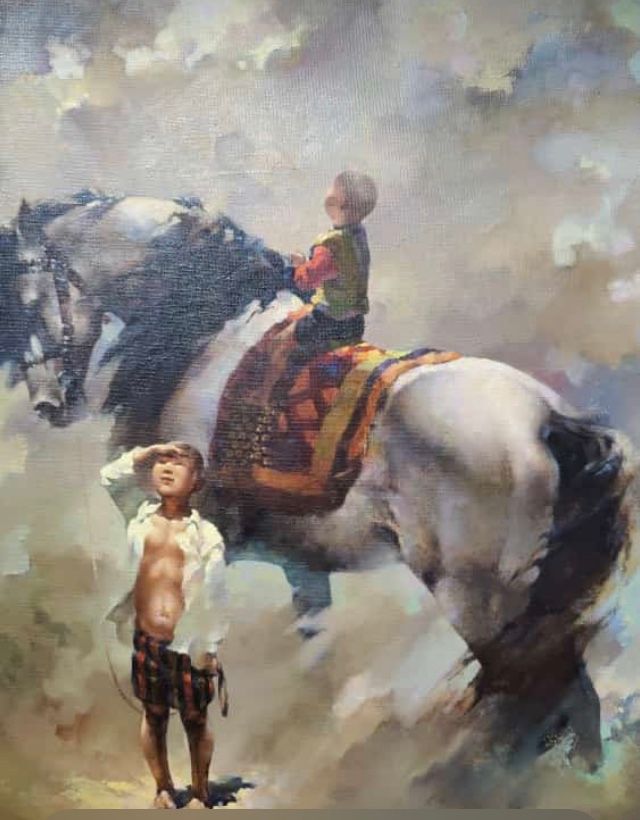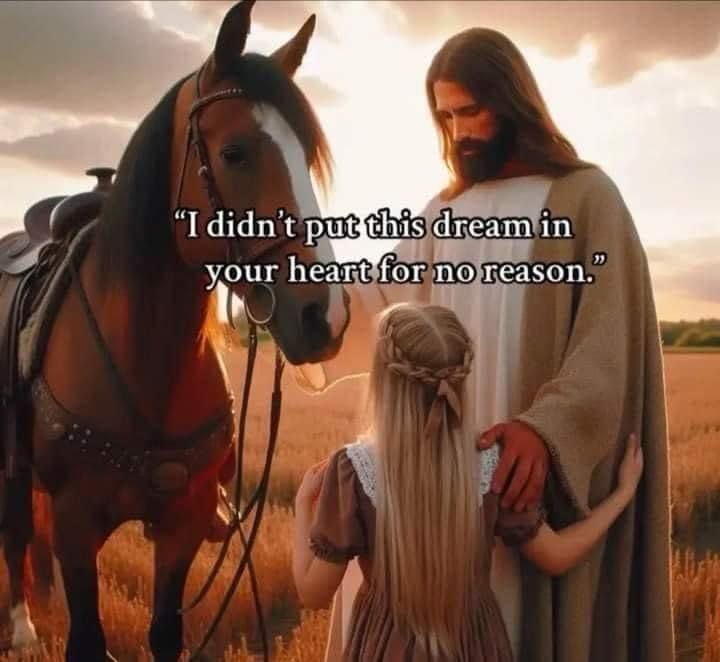Gemeinschaft (von „gemein, Gemeinsamkeit“) bezeichnet in der Soziologie und der Ethnologie (Völkerkunde) eine überschaubare soziale Gruppe (beispielsweise eine Familie, Gemeinde, Wildbeuter-Horde, einen Clan oder Freundeskreis), deren Mitglieder durch ein starkes „Wir-Gefühl“ (Gruppenkohäsion) eng miteinander verbunden sind – oftmals über Generationen.
Die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form des Zusammenlebens und als Grundelement einer Gesellschaft (siehe auch Urgesellschaft).
Das Rechtswesen versteht unter Gemeinschaft eine Rechtsgemeinschaft oder Vertragsgemeinschaft.
Die politische Gliederung Belgiens kennt neben Regionen auch drei „Gemeinschaften“ auf sprachlicher Grundlage (flämisch, französisch, deutsch) als Gliedstaaten des Föderalstaates.
Neuere Konzepte sind zum Beispiel die Ökosiedlung und die Online-Community.
Solche Gemeinschaftskonzepte zielen – gelegentlich sich auf die „organische Solidarität“ Durkheims berufend – auf eine bewusste Integration der sozialen Bindung und der Individualität eines autarken Subjektes zu einem bewussten sozialen Individuum (s. u.: Soziologische Theorie).
Dabei besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Unterschiedlichkeit der Individuen und der Gemeinschaft.
In diesem Zusammenhang spielen Begriffe wie Selbsterkenntnis, Selbstfindung ein Rolle, wobei im Sinne von Jacques Lacan auch das Spiegelstadium genannt wird.
Ziele solcher „emanzipatorischen Gemeinschaften“ sind neben der Überwindung individueller und gesellschaftlicher Entfremdung heute meist Frieden (nach innen und außen), Beheimatung oder Glück, zusammen mit einer Nachhaltigkeit.
Kommunikation und Sprache
Um Miteinander kommunizieren zu können stehen uns Kommunikationsmittel zur Verfügung.
Nicht nur allein über die Sprache können wir Signale an unser gegenüber senden.
Kommunikation (von lat. communicare, „teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, gemeinsam machen, vereinigen“, von lat. communio, „Gemeinschaft“), im abstrakt technischen Sinn die Übertragung bzw. der Austausch von Information, besteht im sozialen Leben idealerweise im wechselseitigen Austausch seelischer Erlebnisse, d. h. von Gedanken, Meinungen, Wissen, Erkenntnissen, Erfahrungen, Gefühlen usw., vorwiegend auf sprachlichem, aber auch auf nonverbalem Weg z.B. durch Gestik und Mimik.
Eine konkrete, raumzeitlich bestimmte Handlung oder deren Ergebnis, durch die laut-, schrift- oder gebärdensprachlich Zeichen hervorgebracht werden, bezeichnet man in der Linguistik als Äußerung.
An der Kommunikation sind vor allem die „sozialen“ Sinne beteiligt, also der Gehörsinn, der Sprachsinn, der Denksinn und der Ichsinn.
Von fundamentaler Bedeutung für die zwischenmenschliche Kommunikation ist das von Rudolf Steiner beschriebene soziale Urphänomen, das er knapp so beschrieben hat:
„... daß wenn Mensch dem Menschen gegenübersteht, der eine Mensch immer einzuschläfern bemüht ist, und der andere Mensch sich immerfort aufrecht erhalten will. Das ist aber, um im Goetheschen Sinne zu sprechen, das Urphänomen der Sozialwissenschaft.“ (Lit.:GA 186, S. 175)
Man kann den Mitmenschen nur dann wirklich verstehen, wenn man im rhythmischen Wechsel ganz in ihm aufgeht und dabei sich selbst vollkommen vergisst, gleichsam in ihn „hinüber schläft“, und dann wieder voll bewusst zu sich selbst zurückkehrt, um sich wach und aufrecht zu erhalten.
Gewinnt einer der beiden Pole das Übergewicht, so verliert man sich entweder im Anderen, oder man verhärtet sich ängstlich, beinahe autistisch in sich selbst.
Eine fruchtbare Kommunikation kommt dann nicht zustande.
Der zwischenmenschliche Verkehr der Menschen ist notwendig aus sozialen und antisozialen Impulsen gemischt.
Ich kann mir ein tieferes soziales Verständnis für den anderen Menschen nur erwerben, wenn ich mich gleichsam von ihm einschläfern lasse und völlig selbstvergessen, d. h. ohne mein eigenes Wesen geltend zu machen, intuitiv in sein Wesen eintauche.
Nur indem ich so mit meinem Bewusstsein, schlafend für mich selbst, ganz im anderen Menschen aufgehe, bin ich sozial.
Das ist auch die Grundlage für echtes Mitgefühl.
Ich muss aber umgekehrt auch wieder für mich selbst erwachen und mein eigenes Wesen geltend machen.
Dann bin ich aber antisozial und muss es auch notwendig sein, wenn meine eigene Individualität im sozialen Kontakt nicht völlig ausgelöscht werden soll.
Nur im rhythmischen Wechselschlag sozialer und antisozialer Impulse kann sich wahre Kommunikation entfalten.
Quelle: anthrowiki.at